|
Borgward-Villa, Horner Heerstraße 11 Geschichte Das Landhaus wurde 1750 vom späteren Bürgermeister
Dr. Hieronymus Klugkist (1711-73) errichtet. Es befand sich an der
Zuwegung zu einem Landgut, das sich mit einer Länge von fast 2
Kilometern von der Horner Heerstrasse bis zum Achterdiek erstreckte.
In alten Karten ist die Parkstruktur deutlich zu erkennen. An der Südseite
zog sich ein breiter baumbestandener Weg entlang, der mit „Die
Allee“ oder „Klugkisten Damm“ bezeichnet wurde. Hinter dem Haus
befand sich ein großer regelmäßiger Gartenteil, der aus vier
Feldern mit einem Wegekreuz bestand. Klugkist vererbte das Landgut an
seinen Sohn Daniel (1748- 1814). Daniel klugkist wurde mit 26 Jahren
in den Senat gewählt, und wurde später Bürgermeister. Ihm fiel am
22. Dezember 1810 die schwere Aufgabe zu, der Bürgerschaft
mitzuteilen, dass Bremen dem französischen Kaiserreich einverleibt
worden sei. Nach seinem Tod wurde es von Heinrich Uhlhorn erworben,
der es 1819 an den Kaufmann Hermann Focke (1766-1824) verkaufte. Focke
ließ es 1819-1820 vom damaligen Stadt- Bau- und Ratszimmermeister
Johann Georg Poppe um oder neu bauen. Nach dem Tod von Herrmann Focke
ging der Besitz an seine Tochter Elisabeth über, die den Kaufmann und
Eltermann Carl Wilhelm Fritze (1791-1842) heiratete. Bis 1915 bleibt
das Gut im Besitz der Familie Fritze. 1921 erwirbt es der Geheime
Kommerzienrat und Hansa-Lloyd-Direktor Dr. Robert Anton Hinrich
Allmers (1872-1951), der es 1921 nach den Plänen von Rudolf Alexander
Schroeder umbauen lässt. Nachdem Allmers 1931 Bremen verlassen hat,
wird es von verschiedenen Mietern bewohnt. 1936 wurde der dazugehörige
Park vom Bremer Staat erworben und an den Rhododendronpark
angeschlossen. Der Parkteil trägt weiterhin den Namen Allmers Park.
1955 feierte Borgward hier seinen 65 Geburtstag, an dem ihm durch Bürgermeister Wilhelm Kaisen das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Am 28. Juli 1963 starb C. Borgward in seinem Schlafzimmer in Horn. Nach dem Tod von C. Borgward wurde das Haus von seiner Witwe und seinen Kindern bis 2000 bewohnt. Wenige Jahre später wurde es von einem Geschäftsmann erworben, der es innen für Geschäftsräume umbaute. Am Ende des Gartens baute er sich ein als Pendant ein Wohnhaus, das dem Stil der Villa angepasst ist. Seit 1973 steht es unter Denkmalschutz. Architektur
1862 wurden im Dachgeschoss Zimmer eingerichtet.
Das Gebäude wurde aufgestockt und erhielt einen Dreiecksgiebel, den
das Wappen der Familie Focke-Fritze bis zum letzten Umbau zierte. Die
vier Pilaster im Erdgeschoss wurden im neuen Erker mit ionischen
Kapitellen fortgeführt. Abgeschlossen wurde der Erker von einem
flachgeneigten Dreieckgiebel. Die alten Dachpfannen wurden später
durch Weserplatten (Schiefer) ersetzt. Rudolf Alexander Schröder
erweiterte den Erker auf beiden Seiten um eine Fensterachse und vergrößerte
den Mittelraum im Erdgeschoss der Gartenseite. Der Vorbau, der einen Söller
trägt, wurde an den Seiten durch Pergolen erweitert, die an den Ecken
durch ionische Säulen gestützt wurden. |
||||||
| (D1) Bremer Häuser erzählen Geschichte, Band 1, 1998, (D2) Bremer Häuser erzählen Geschichte, Band 2, Bremen 2001, Döll Edition Landesamt für Denkmalpflege |
||||||
| DRUCKEN | FENSTER SCHLIESSEN |
 1938 wurde das Landhaus an den Kaufmann August
Georg Nebelthau verkauft. Während der Besatzungszeit wurde es von den
Amerikanern bewohnt, bis es im Juni 1952 vom Automobilbauer Carl F. W.
Borgward erworben wurde. Borgward ließ es 1952-1953 vom Architekten
Rudolf Lodders nach seinen Vorstellungen umbauen. Anstelle vieler
kleiner Räume entstanden eine Große Halle, das Esszimmer und die
Bibliothek. Am ursprünglichen Ort blieben lediglich die Küche und
die Wirtschaftsräume.
1938 wurde das Landhaus an den Kaufmann August
Georg Nebelthau verkauft. Während der Besatzungszeit wurde es von den
Amerikanern bewohnt, bis es im Juni 1952 vom Automobilbauer Carl F. W.
Borgward erworben wurde. Borgward ließ es 1952-1953 vom Architekten
Rudolf Lodders nach seinen Vorstellungen umbauen. Anstelle vieler
kleiner Räume entstanden eine Große Halle, das Esszimmer und die
Bibliothek. Am ursprünglichen Ort blieben lediglich die Küche und
die Wirtschaftsräume. 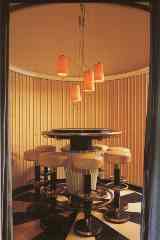 Im ersten Stock befanden sich die Eltern-,
Kinder, Gäste- und Mädchenzimmer mit jeweils einem Bad. Die Räume
wurden mit praktischen Einbaumöbeln, Bücherregalen, Sofas und Türen,
die Wandschränke verbargen versehen. Auch eine Bar aus gelbem
Kunstleder wurde eingebaut. Der Garten wurde vom Horner Garten- und
Landschaftsarchitekten Bernd Kuhlwein umgestaltet, die alten Bäume,
der gewaltige Liriodendron, die Sumpfzypresse, die Akazie und Zeder
blieben erhalten.
Im ersten Stock befanden sich die Eltern-,
Kinder, Gäste- und Mädchenzimmer mit jeweils einem Bad. Die Räume
wurden mit praktischen Einbaumöbeln, Bücherregalen, Sofas und Türen,
die Wandschränke verbargen versehen. Auch eine Bar aus gelbem
Kunstleder wurde eingebaut. Der Garten wurde vom Horner Garten- und
Landschaftsarchitekten Bernd Kuhlwein umgestaltet, die alten Bäume,
der gewaltige Liriodendron, die Sumpfzypresse, die Akazie und Zeder
blieben erhalten.

